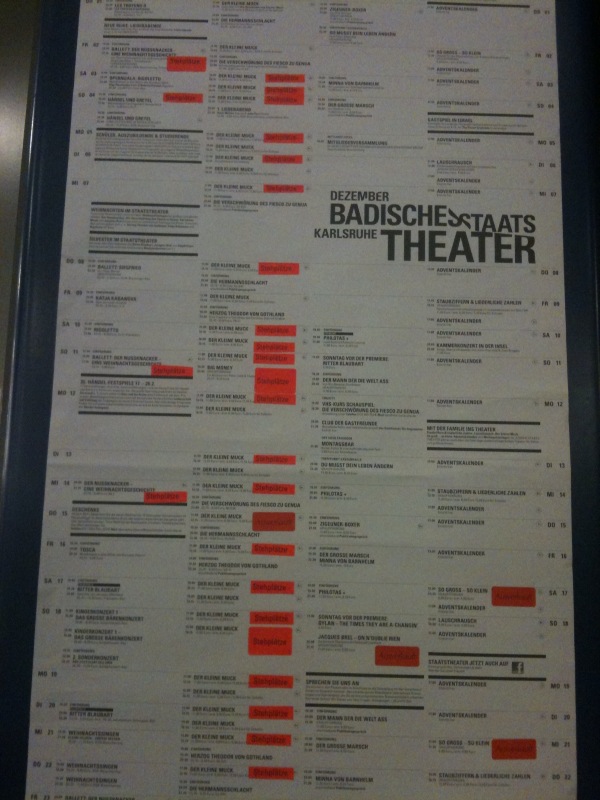Zum Auftakt präsentiert das diesjährige Karlsruher Händel Festival einen Highlight in Szene und Musik, eine echte Rarität, Händels Oper über König Richard Löwenherz, der seine Braut, die spanische Prinzessin Costanza, aus der Gefangenschaft und von den Gelüsten des tyrannischen Königs von Zypern befreit. Zu Hilfe kommen ihm dabei dessen Tochter Pulcheria und Oronte deren Geliebter. Doch die Handlung ist bei diesem Feuerwerk von Arien jeglichen Typus, das in dieser Oper ‚abgebrannt‘ wird, nur eine quantité négligeable.
Primo Uomo und Primadonna, Riccardo und Costanza (in den Personen von Franco Fagioli und Emily Hindrichs), Secondo Uomo und Seconda Donna, Oronte und Pulcheria (in den Personen des Nicholas Tamagna und der Claire Lefilliâtre), singen, wenn ich Recht gezählt habe, an die dreißig Arien. Und eine ist schöner und brillanter als die andere. Hinzu kommt das Duett im Finale des zweiten Akts, das Riccardo und Costanza singen. Dieses „T’amo, sì“ ist geradezu überwältigend schön – ein absoluter Highlight unter den Händel Duetten.
Es mag ja sein, dass einst im Jahre 1727, als am King’s Theatre am Haymarket in London Senesino und die beiden Diven, die Cuzzoni und die Bordoni, im Riccardo Primo um die Wette sangen, dass da alles noch viel schöner klang. Doch wenn wie jetzt in Karlsruhe ein alle anderen Mitwirkenden überragender Franco Fagioli als liebender und kriegerischer Riccardo so scheinbar mühelos durch die Register und Koloraturen eilt, wenn Emily Hindrichs als unglückliche Prinzessin mit ihrer so eigentümlich sanften Stimme brilliert, dann glaubt man als Zuhörer zu ahnen, wie eine Opera seria in der Händel Zeit geklungen haben muss und welch exaltierende Wirkung, welchen Zauber, Musik und Gesang auf die damaligen Zuhörer ausgeübt haben müssen. Riccardo Primo, wie er in Karlsruhe von einem hochkarätigem Ensemble gesungen wird, wie die „Deutschen Händel-Solisten“ unter Michael Hofstetter diese Musik zelebrieren, das ist Händel vom Allerfeinsten, Opernkulinarik par excellence.
Zu dieser Illusion, eine perfekte Opernaufführung in der Händel Zeit zu erleben, trägt nicht zuletzt die Inszenierung bei. Das Produktionsteam der französischen Barockspezialisten um den Regisseur Benjamin Lazar, kreiert in der Tat barockes Theater, eine historisierende Aufführung, bei der alles stimmt: die prachtvollen Kostüme, die sparsamen, die rituellen Gesten der Sänger, die stets vornehme Zurückhaltung, die auch in Augenblicken größten Leidens alle Ausbrüche vermeidet, stets die Contenance bewahrt, die Personenregie, die Damen und Herren von Stand stets stumme Begleiter als Beobachter und Diener zuordnet, eine Bühnenmaschinerie, die Paläste und Gärten und Thronsäle bereit stellt, eine Lichtregie, die auf jede moderne Technik verzichtet und die Bühne allein mit Kerzenlicht ausleuchtet, ohne dass die Sänger dabei je aus dem Blickfeld der Zuschauer gerieten.
Mit anderen Worten: in Karlsruhe ist eine geradezu perfekte historisierende Aufführung von Riccardo Primo gelungen – gleichermaßen in Szene, Orchesterklang und Gesang. Ein faszinierender Opernabend – wenn man diesen Stil mag. Ein Stil, der uns, die wir vom ‚Regietheater‘ verwöhnt und vielleicht auch deformiert sind, fremd dünkt und der doch gerade in seiner Fremdheit und gezielten Stilisierung ein ganz besonderes Opernerlebnis verschafft. Wenn Riccardo Primo im nächsten Jahr wiederaufgenommen wird, möchte ich die Aufführung nicht versäumen.
Wir sahen die Premiere am 23. Februar 2014.