Im Vorfeld der diesjährigen Festspiele hat man in Karlsruhe eine weise und in sich konsequente Entscheidung getroffen. Wie einstens Händel bei der Londoner Uraufführung seines dramma per musica hat man auf die Zugkraft der Gesangsstars gesetzt, diese gleichsam um die Wette singen lassen und Regie und Bühnenbild zur quantité negligeable reduziert. So war denn in Karlsruhe nicht Musiktheater oder gar ‚Regietheater‘, sondern ein Fest der Stimmen und der Musik zu erleben.… → weiterlesen
Archiv der Kategorie: Karlsruhe
Von starken Frauen und Jammerlappen: Hector Berlioz, Les Troyens. Teil II: Les Troyens à Carthage im Badischen Staatstheater Karlsruhe
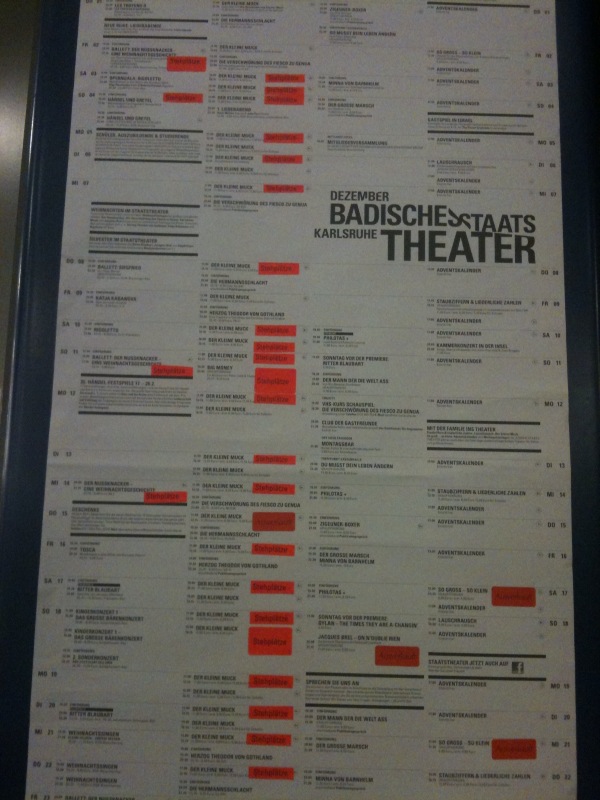
„Von Helden“ verkündet vollmundig das hauseigene Theatermagazin, so laute in den Jahren 2011/2012 das Spielzeitmotto in Karlsruhe. Eine seltsam befremdliche Wahl, bei der es wohl darauf ankommt, „Helden“, wenn es denn je welche gab, vom Sockel zu stürzen. Bei den Opernhelden, heißen sie nun Ruggiero, Lohengrin, Siegmund, der Herzog von Mantua oder ich weiß nicht wie, ist das eine leichte Aufgabe, zumal diese Helden bei ihrem Auszug zu neuen Taten über Leichen (vorzugsweise Frauenleichen) zu gehen pflegen. Der Karlsruher Held Äneas, den sich Berlioz als sein eigener Librettist frei nach Vergils römischem Nationalepos, der Äneis, modelliert hat, macht da keine Ausnahme.… → weiterlesen
Neubayreuth und Altbayreuth und rauschhafte Klänge. Der Ring im Badischen Staatstheater Karlsruhe
Es muss nicht immer Wien, Berlin oder Paris sein. Auch in manch deutscher ‚Provinzstadt` versteht man sich auf Wagner. Auch in mittelgroßen Häusern wie eben in Karlsruhe weiß man den ‚Ring zu schmieden‘. Jetzt über die Osterfeiertage wurde dort der in den Jahren 2004 bis 2006 erarbeitete Ring noch einmal, „zum letzten Male“ gezeigt – in einer fulminanten Aufführung, die zu Recht vom Publikum stürmisch gefeiert wurde. Wir hatten vor ein paar Jahren schon die Walküre aus dem Karlsruher Ring Zyklus gesehen. Schon damals hatten uns der rauschhafte Wagnerklang, den Maestro Justin Brown mit der Badischen Staatskapelle hervor zu zaubern wusste, die hochkarätigen Sänger, die in Karlsruhe singen und agieren, die Inszenierung mit ihren Neubayreuther Verweisen und ihren ironisch gebrochenen Altbayreuther Referenzen begeistert. Eine Begeisterung, die jetzt, wo wir den gesamten Karlsruher Ring gesehen haben, nicht geringer geworden ist. Es ist einfach bewundernswert, wie Lance Ryan – schon vom Äußeren her ein hoch gewachsener athletischer Siegfried Typ – mit nimmermüder Kraft und Ausdauer und dazu noch mit sanften leisen Lyrismen die Figuren des Sigmund und der beiden Siegfriede gestaltet oder mit welcher Bühnenpräsenz Thomas J. Mayer den Walküre Wotan singt und spielt oder wie souverän Caroline Whisnant trotz all der der Behinderungen durch die schwere Altbayreuther Kostümierung alle drei Walküren singt. Auch das übrige Ensemble ließ kaum Wünsche offen. Und der Orchesterklang? Rauschhafter Wagner Sound, der frei nach Nietzsche die stärksten Stiere umwirft. Die Feuilletonkritiker, die vor Jahren die Premieren gesehen haben, werden wohl an dem einen oder anderen herumgemäkelt haben. „Allein was tut’s“. Ich habe in Karlsruhe einen fulminanten Ring gehört. Der Dilettantin hat es gefallen. Es hat ihr – welch ein Sakrileg – sogar besser gefallen als in Paris und Berlin, wo sie unlängst den Siegfried bzw. die Walküre gesehen hat. Nicht nur der musikalische Part auch die Inszenierung beeindruckt. Denis Krief, der für „Regie, Bühne und Kostüme“ verantwortlich zeichnet, verzichtet auf alle Anleihen beim Dekorationstheater, bei der Grand Opéra oder beim ‚Maschinentheater‘ (einer Vorliebe, die – so war es am Montag in der FAZ zu lesen – Lepage gerade bei seiner Produktion der Walküre in der Met gefrönt hat). In Karlsruhe genügen die Drehbühne, ein Holzgerüst, das Schmiede, Wald, Drachenhöhle sein kann, ein kleines Podest als Felsen der Walküre, spielerisch eingesetzte Hologramme für des „Rheines Tiefe“ und das Rheingold, für den Feuerzauber oder Siegfrieds Rheinfahrt oder für das Seil der Nornen. Ein Minimalismus, der wohl den Neubayreuther Stil implizit zitiert, ihn aber auch wieder zurücknimmt und implizit Altbayreuth zitiert, wenn er die Walküren in schwere lange Kostüme kleidet, ihnen turmhelmartige Frisuren verpasst oder Alberich in eine braune Mönchskutte kleidet und den Wotan der Walküre in ein ähnliches Kostüm steckt. Spektakulär ist das Finale, das gegen die gängigen Erwartungen nicht als erlösendes Ende und Neubeginn in Feuer und Wasser inszeniert wird, sondern als Endlosschleife, als ewige Wiederkehr des Gleichen. Die Drehbühne wird zum Karussell, in dem Götter und Walküren zu Mumien, zu in sich verfallenden Mumien geworden sind. Nur die Rheintöchter und Alberich sind geblieben. Und das ewig gleiche Spiel um Macht und Gier, Lust und Leid wird von Neuem beginnen. Wir sahen den Ring Zyklus in den Vorstellungen vom 20. Bis zum 25. April.
Eine Mini – Csardasfürstin mit Händel Soundtrack. Partenope bei den Händel Festspielen in Karlsruhe
Eine Mini – Csardasfürstin mit Händel Soundtrack. Partenope bei den Händel Festspielen in Karlsruhe
Bei den Karlsruher Händel-Festspielen, die heuer zum 34. Male veranstaltet wurden, habe ich in den letzten Jahren so manch hochrangige Aufführung gesehen: einen konsequent historisierenden Radamisto, einen Giulio Cesare als karnevaleskes Metatheater, einen Ariodante als Spiel mit der Scheinwelt des Theaters. Doch in diesem Jahr ist das Händel Unternehmen wohl ein wenig müde und matt geworden und hat etwas zu viel der Patina angesetzt. Dabei hatte man mit der Partenope doch eigentlich eine sehr gute Wahl getroffen, mit der man leicht an die Erfolge der vergangenen Jahre hätte anschließen können. Doch die Möglichkeiten wurden nur teilweise genutzt. Zwar braucht man Partenope (neben der Semele wohl die zweite Händel ‚Operette’) nicht gleich wie vor einem Jahr im Theater an der Wien als Soap Opera zu spielen. Die Geschichte von der Sirene Partenope (der mythischen Gründerin der Stadt Neapel) und ihren drei rivalisierenden Liebhabern, die sich mit der Geschichte einer rachsüchtigen Frau überkreuzt, die unbedingt ihren Liebhaber wieder haben will, der sich inzwischen in den Fängen der Partenope befindet, eignet sich von Struktur und Personenkonstellation her auch für eine klassische Operette. Soap Opera und Operette – eine Banalität, die Theatermacher und Publikum seit ewigen Zeiten vertraut ist – brauchen Tempo und Witz, Pointen und stets neue überraschende Regieeinfälle. In Wien gab es davon in Hülle und Fülle. Doch bei der Karlsruher Partenope da fehlt es an alledem. Zwar wird von einem jungen Ensemble brillant gesungen – bis hin zum Wettstreit der Countertenöre -, zwar spielen die „Deutschen Händel-Solisten“ unter der Leitung von Michael Hofstetter wie immer einen Händel der Extraklasse. Doch die Inszenierung zieht sich schwerfällig und oft langweilig dahin. Die Sänger werden als Schauspieler kaum gefordert, stehen als gelangweilte Partygäste, die der reichen Gastgeberin den Hof machen, in einem großbürgerlichen Haus herum, halten sich am Drink fest und dürfen hin und wieder Billard spielen. Warum der kleine, so unbeholfene secondo uomo am Ende die Primadonna kriegt, der primo uomo sich mit der seconda donna begnügen muss, ja das wüssten wir wirklich alle gerne. Zwänge des Librettos, die uns die Regie nicht erklären und schon gar nicht ändern mag. Wie dem auch sei. Wer Händel nur hören wollte, der erlebte Hochgenuss. Wer sich eine effektvolle, geistreiche Inszenierung erhoffte, der wurde enttäuscht. Wir sahen die Premiere am 19. Februar 2011.
„Die Zeit, die ist ein sonderbares Ding.“ Ein Rosenkavalier der Vergänglichkeit in Karlsruhe
„Die Zeit, die ist ein sonderbares Ding.“ Ein Rosenkavalier der Vergänglichkeit in Karlsruhe
Nach dem szenisch und wohl auch musikalisch reichlich misslungenen Samson präsentiert das Badische Staatstheater am Abend darauf den Rosenkavalier: einen sanften, zurückhaltenden oder auch, wenn man so will, einen konventionellen Rosenkavalier, der auf den ersten Blick auf allen inszenatorischen Ehrgeiz zu verzichten scheint. Will das Produktionsteam im Bühnenbild, in der Ausstattung, im Auftritt der Personen vielleicht die Dresdner Uraufführung nachstellen oder zumindest mit sanfter Ironie und vorsichtiger Parodie auf die Rezeptionsgeschichte verweisen? – so fragt sich zunächst die etwas irritierte Zuschauerin. Da finden sich auf der Bühne das elegante Boudoir der Hochadligen, das protzige Palais des reichen Bürgers, das Heurigenlokal in der Vorstadt, die barocken Staatsroben, die Perücken, die Unzahl der Lakaien, der Don Juan vom Lande und sein halbdebiles Gefolge, das schüchterne und doch zugleich zielstrebige Mädchen, der androgyne Jüngling, die schöne und noch immer sehr jugendliche große Dame. Eigentlich alles, wie man das so kennt. Und doch ist alles ein bisschen anders, und diese Variatio, diese unaufdringliche Variation des Althergebrachten macht den Reiz der Aufführung aus. Die Zeit, die vergehende Zeit („In den Gesichtern rieselt sie, im Spiegel da rieselt sie…“), ist das Grundmotiv der Inszenierung: ein schöner Einfall, eine Sichtweise ganz im Sinne eines barock verstandenen Hofmannsthal. Hat man den Vanitas Gedanken, der eben nicht nur Vergänglichkeit, sondern auch die Lust an der Vergänglichkeit bedeutet, einmal als Grundkonzeption der Inszenierung verstanden, dann befremdet das scheinbar Historisierende nicht mehr. Die Zitate aus der Rezeptionsgeschichte, eben aus einer vergangenen Zeit, und ihre mal vorsichtigen, mal plakativen Brechungen erscheinen dann nur konsequent. Vielleicht wird die Konzeption im ersten Akt noch nicht ganz deutlich, im zweiten und vor allem im dritten Akt wird sie geradezu überdeutlich. Mag der sommerliche Heurigengarten im dritten Akt noch eher ein vorsichtiges Absetzen von der Tradition der dämmrigen Schuppen als Ort der Handlung sein, so ist der zweite Akt geradezu ein Zitatenkonglomerat aus Altem und Neuem: aus dem scheinbar so konventionellen Lever im Boudoir ist eine Holiday on Ice Show im Foyer der Semper Oper geworden, in der das neue Paar indes etwas verloren wirkt. Das Pseudoballett der Choristen agiert dafür umso wuchtiger (das Eislaufen hat man indes den Choristen erspart. Das haben ein paar schlanke Jünglinge aus der Statisterie übernommen). Im dritten Akt wird das Leitthema der Vergänglichkeit geradezu parodiert. Aus dem „kleinen Mohren“, der noch im ersten Akt für die Schokolade und den Transport der silbernen Rose zuständig war, ist im letzten Akt ein hoch gewachsener Farbiger im weißen Anzug geworden, ein Zuschauer, den die Maskerade amüsiert, die da vonstatten geht, ein Rosenverkäufer, der das Taschentuch aufnimmt, das Sophie aus dem Alkoven wirft und der eine rote Rose vor der Bettstatt deponiert. Kitsch pur? Natürlich. Aber ein sanfter. Und während das neue Paar sein berühmtes Schlussduett singt, entledigt sich die Marschallin der Staatsrobe und der Perücke und steht wie am Anfang im Negligé da – und macht sich auf die Suche nach einem neuen Liebhaber. Die vergangene Liebe macht Platz für eine neue. Ein bisschen banal. Aber warum auch nicht. Die vergehende Zeit, die ist halt „ein sonderbares Ding“. Phrasen, wie Oktavian zu Recht bemerkt (und wie sich Hofmannsthal korrigiert): „Sie spricht ja heute wie ein Pater“.
Ein schöner Abend – ganz im Gegensatz zu dem ärgerlich verlorenen gestrigen. Eben die „schöne Musik“ – detailverliebt dirigiert und mit wenigen Ausnahmen recht brillant gesungen. Wir sahen die Vorstellung am 16. Oktober 2010. Die Premiere war am 10. Juli 2010.
Unterammergau ohne Stückl. Oder wie ein bekannter Tenor sich als Hauptdarsteller, Regisseur und Ausstatter in Personalunion versucht: Samson und Dalila im Badischen Staatstheater Karlsruhe
Die Mär von der niederträchtigen femme fatale und dem tölpelhaften Kraftmeier Samson ist halt eine schlimme Geschichte. Doch ganz schlimm wird sie, wenn sie jemand in Szene setzt, der weder über eine tragfähige Konzeption noch über die handwerklichen Fähigkeiten verfügt, die man eigentlich von einem Theatermacher erwartet.
In Köln hatte im vergangenen Jahr Tilman Knabe die biblische Erzählung vom Krieg der Israeliten mit den Philistern und von der schönen Dalila, die den einfältigen Muskelprotz der Israeliten erledigt, als aktuelle Variante vom ewigen Hass und von permanenten Gewaltexzessen zwischen verfeindeten Völkern oder Stämmen oder Gruppen neu erzählt. In Köln geschieht dies mit den Mitteln des Films: mit Zitaten aus den Genres des Kriegsfilms und des französischen Gangsterfilms. Und die heikle Schlussszene – ein wieder zu Kräften gekommener Samson reißt den Tempel der Feinde ein – wird erst gar nicht realisiert.
Die größten Gewaltexzesse ereignen sich in der Phantasie, in der perversen Gewaltphantasie, in der von der medialen Gewalt infizierten Phantasie des Zuschauers. Nicht so anspruchsvoll war man in St. Gallen. Dort beim sommerlichen Festspektakel auf der Freilichtbühne vor dem Dom hatte man Samson und Dalila als bunten Bilderbogen aus den Märchen von Tausend und einer Nacht verstanden. Und in Karlsruhe? Da weiß man nicht so recht, was man will. Ein bisschen alttestamentarischer „Krippenspielrealismus“? Ein bisschen Sadismus? Ein bisschen Kastrationsangst des armen Macho? Ein bisschen Traumtheater? Ein bisschen Nazi Perversionen? War es das? Ort der Handlung ist ein Konzentrationslager. Oder vielleicht auch ein Auffanglager für Latinos in Arizona, die von einem machtlüsternen Sheriff drangsaliert werden? Oder vielleicht auch eine Bohrinsel, die zum Konzentrationslager umfunktioniert wurde? Die drei Stahlkonstrukte, die herumstehen, erinnern an Wachttürme oder auch an Bohrtürme. Alte, Frauen und Kinder – letztere dürfen zwischendurch ein bisschen fangen spielen – liegen jammernd am Boden, und ein wohlgenährter langhaariger Samson stachelt zum Aufstand an und erledigt schon mal den schwarz gekleideten Kommandanten. Den SS-Offizier? Eine Aktion, die den Oberkommanten – im Libretto der Oberpriester der Philister – beträchtlich in Rage bringt.
Keine Sorge, liebes Publikum. Gleich kehrt Ruhe ein. Gleich dürfen die matten Krieger träumen. Da kommt auch schon eine Schar weiß gekleideter blonder Mädchen (Priesterinnen der Aphrodite? Schülerinnen eines Mädcheninternats, einer Waldorfschule, die sich alle in weiße Gewänder gehüllt haben?) und kümmert sich um die müden Männer. Samson stört das nicht weiter. Er ist erschöpft von der Treibjagd auf die Feinde. Die Anführerin der Mädchenschar (die Oberpriesterin der Aphroditejüngerinnen?, die Direktorin der Waldorfschule?) – eine blonde Dame in Schwarz – macht dem Helden gewisse Avancen und singt ihm und uns Zuschauern (leider ein wenig hölzern) das berühmte Frühlingslied – einen Hit aus der Oper, den wir alle kennen.
Im zweiten Akt hat sich auch Dalila in Weiß geworfen und räkelt sich mit ihren Mädchen in weißen Tüchern und Schleiern auf der Vorderbühne. Sind wir im Harem oder vielleicht in einer Versammlung von zärtlich miteinander spielenden Lesben? Der sehnsüchtig erwartete Samson, als er denn endlich erscheint, ist von dieser Situation völlig überfordert und steht erstmal nur so herum (der viel beschäftigte Sänger-Regisseur hatte offensichtlich nicht die Muße, sich auch noch mit der Personenregie zu beschäftigen. Sei’s drum). Immerhin kriegt die böse Dalila, die den verführerischen Charme einer frustrierten Hausfrau ausstrahlt und die der Oberkommandant zuvor so richtig heiß gemacht hat, den Trottel von Samson schließlich doch noch herum. Im dritten Akt sind wir dann so richtig im KZ. Eine sadistische Wachmannschaft treibt ihre Spielchen mit dem jammernden Samson und seinen Gefährten. Dalila ist zur Domina mutiert und macht zwischendurch auch mal die Hilfspriesterin für den Oberpriester.
Und zum Finale darf der geschundene Samson an den Türmen wackeln, die aber mitnichten zusammenbrechen, sondern sich nur ein wenig zur Seite neigen. Immerhin ein plausibler Grund dafür, dass die Vielzahl der Choristen und Statisten, nicht zu vergessen die große Schar der Kinder, die alle auf der Bühne versammelt sind, mausetot spielen dürfen und dass das sowieso schon dämmrige Licht ganz ausgeht. Und wenn es dann gleich wieder angeht, dann sind alle im Opernhaus, die auf der Bühne und die im Zuschauerraum, mehr als begeistert. Welch grandioses Spektakel hat uns doch unser Tenor aus Argentinien bereitet. Perdón, muy estimado Senor Cura: Sie sind zweifellos ein sehr guter Sänger. Doch bevor Sie sich das nächste Mal als Theatermacher versuchen, schauen Sie sich doch bitte ein paar Videos von Konwitschny, von Loy und von Guth an. Oder noch besser: nehmen sie ein paar Nachhilfestunden bei diesen Herren.
Wir sahen die Premiere am 15. Oktober 2010.

